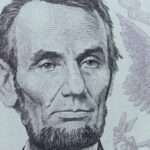Resilienz und Selbstbewusstsein
von coach | Dez 11, 2022 | Selbst, Selbstbewusstsein
Der Begriff der Resilienz stammt ursprünglich aus der Physik und beschreibt die Elastizität eines Werkstoffs oder die Widerstandsfähigkeit eines Systems gegenüber Störungen. Ein anschauliches Beispiel für sehr große Resilienz ist, wenn man in der Physik bleibt, ein...